T I T A N
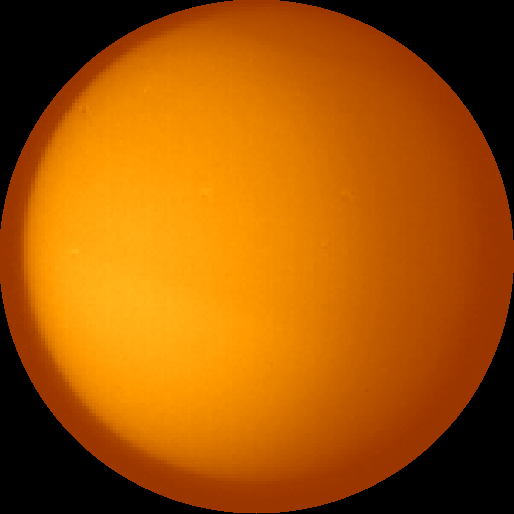
Versetzen wir uns ins Jahr 1655. 45 Jahre zuvor hatte Galileo Galilei
vier Jupiter-
monde entdeckt, die ersten Monde eines anderen Planeten überhaupt.
Und nun
richtete Christiaan Huygens sein Fernrohr am 25. März auf den
Saturn und
entdeckte den ersten Saturnmond. Huygens hätte mit seinem Fernrohr
auch
noch weitere Saturnmonde entdecken können, aber er glaubte an
die heute
seltsam anmutende Logik, dass mit sechs Planeten (Merkur, Venus, Erde,
Mars, Jupiter und Saturn) und sechs Monden (einem Erdmond, vier
Jupitermonden und einem Saturnmond) eine "Symmetrie" gegeben sei
und somit kein weiterer Körper mehr existieren sollte, und suchte
keine
weiteren Monde. Dieser erste und größte Saturnmond bekam
später
den Namen Titan, nach dem Göttergeschlecht
der Titanen (vom
griechischen Wort für "die sich anstrengen", "Streber"), der Kin-
der und einiger der Enkel und Urenkel von Tellus und Uranus.
Einer der Titanen war Saturn. Als sechstinnerster der großen
Saturnmonde erhielt Titan die Bezeichnung
Saturn VI.

Lange Zeit galt Titan als der größte
Mond im Sonnensystem mit einem Durchmesser von
etwa 5550 km. Doch 1980 zeigte die Sonde Voyager 1, dass Titan
eine dichte Atmo-
sphäre besitzt, die ihn so groß erscheinen lässt; sein
wahrer Durchmesser beträgt "nur"
5150 km, somit ist er nach Ganymed (5262 km Durchmesser) immerhin der
zweit-
größte Mond im Sonnensystem sowie der mit Abstand größte
Saturnmond
(er
macht etwa 95 % der Gesamtmasse aller Saturnmonde
aus). Außerdem ist er
größer als der Planet Merkur.
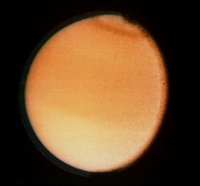
Titan besteht je etwa zur Hälfte aus
Eis und aus Gestein. Er ist wahrscheinlich folgendermaßen
aufgebaut: Im Innern befindet sich ein großer Kern aus Gestein
mit einem Durchmesser von
3400 Kilometern. Dieser wird von mehreren Schichten aus verschiedenen
kristallinen
Eisformen umgeben. Titans Inneres ist
möglicherweise noch heiß.

Aufnahme von Huygens am 14.01.2005.
Die größten der hier erkennbaren Eisbrocken
haben einen Durchmesser von ca. 15 cm.
Titans Oberfläche besteht hauptsächlich
aus einem Gemisch von trübem (Wasser-)Eis und Kohlenwasserstoffeis.
Die Sonde Huygens, die am 14. Januar 2005
sanft auf Titan landete, machte Aufnahmen,
die eine allem Anschein
nach von Erosion geformte Landschaft mit Fließrinnen, küstenähnlichen
Gebieten und sogar kieselsteinförmigen
Objekten auf der Oberfläche zeigen (siehe Abbildungen). Einige
Bilder zeigen ein komplexes Netz schmaler
von einer Flüssigkeit ausgewaschener Fließrinnen, die von
helleren Hochgebieten in niedrigere und flachere
dunkle Regionen reichen. Aus diesen Rinnen bilden sich Flusssysteme,
die zu ausgetrockneten Seen führen,
in denen "Inseln" und "Sandbänke" liegen (siehe Abbildung), die
bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit denen
auf der Erde aufweisen. Andere Bilder zeigen eine Art kleine runde
Kieselsteine in einem ausgetrockneten
Flussbett, die offenbar aus schmutzigem Eis bestehen, jedoch wegen
der auf Titan herrschenden niedrigen
Temperaturen hart wie Stein sind. Titans
Boden scheint zumindest teilweise aus Ablagerungen des den
Saturnmond umgebenden organischen Dunstes zu bestehen. Dieses dunkle
Material aus der Atmosphäre
konzentriert sich bei Methanniederschlägen am Boden von Fließrinnen
und Flussbetten und trägt zu den
auf den Bildern sichtbaren dunklen Gebieten bei. Krater gibt es auf
Titan
nur sehr wenige, die
Oberfläche ist also sehr jung, im Mittel etwa 100–300 Millionen
Jahre alt.
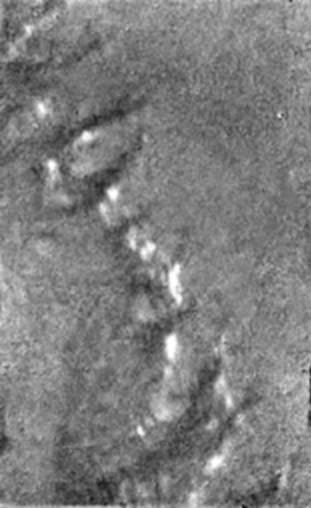
"Inseln" in einer dunklen Tiefebene
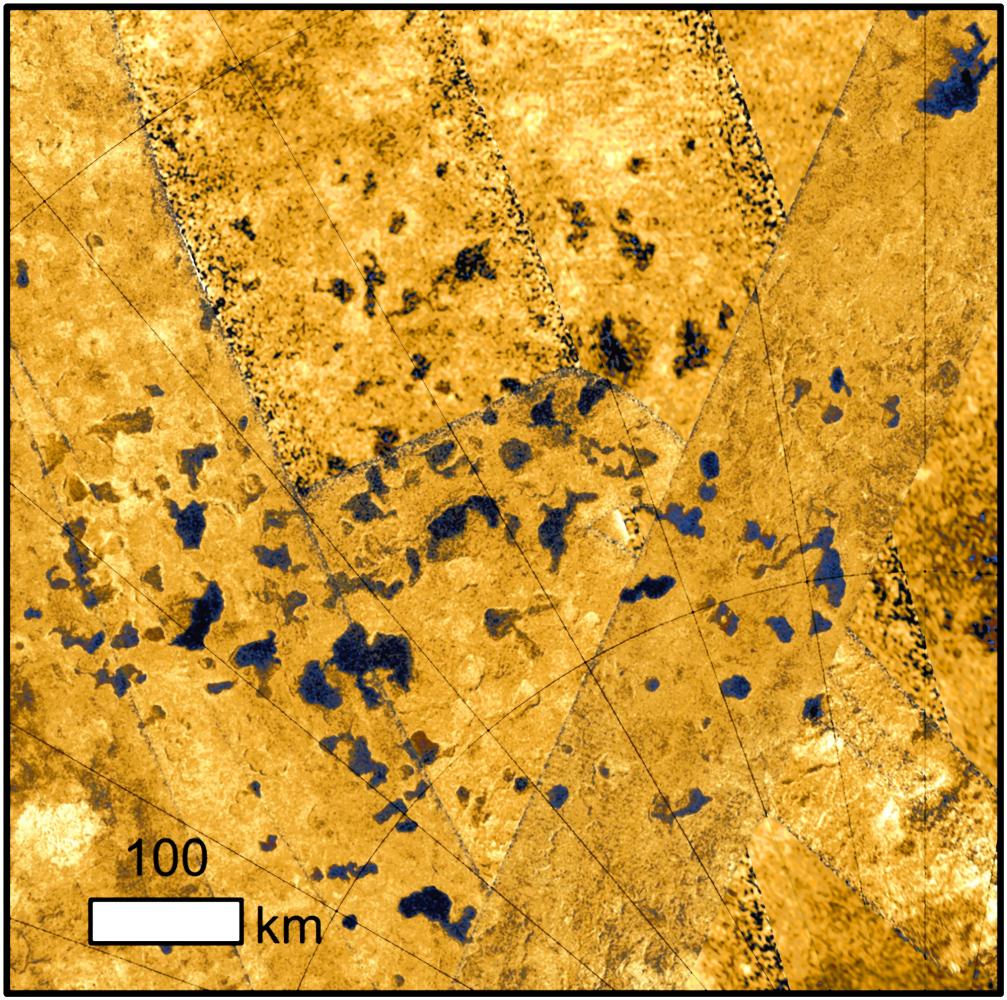
Seen auf Titan. Aufnahme von der Raumsonde Cassini.
Titans Atmosphäre ist hochinteressant.
Titan
besitzt nämlich als einziger Mond im Sonnensystem eine dichte
Atmosphäre. Sie ist in Bodennähe sogar fünfmal so dicht
wie die der Erde. Die dichteren Schichten der Titan-
atmosphäre haben zusammen eine Dicke von über 500 Kilometern
und sind somit auch viel dicker als die der
Erdatmosphäre, die zusammen nur etwa 100 Kilometer dick sind.
Der "Luftdruck" der Titanatmosphäre
beträgt am Boden mehr als 1500 hPa (Erde: 1013 hPa) und in 175
km Höhe immerhin noch 1 hPa (bei der
Erde ist das bereits in 50 km Höhe der Fall). Sie besteht hauptsächlich
aus Stickstoff, nämlich in Bodennähe
zu 90 %, in der Stratosphäre zu 97 % und in den oberen Schichten
vermutlich sogar zu 98 %. Der andere
wichtige Bestandteil ist Methan, dessen Anteil in Bodennähe 5
% und in der Stratosphäre 2 % beträgt. In
etwa 300 km Höhe werden Methan- und Stickstoffmoleküle
durch die UV-Strahlung der Sonne und durch
Elektronen in der Magnetosphäre Saturns aufgespalten und können
dann komplexere Moleküle wie
Ethan, Ethin, Propan oder Cyanwasserstoff (Blausäuregas) bilden.
Das Ergebnis ähnelt dem Smog
über großen Städten, nur titanweit und viel dichter.

Nebel und Dunst über dem Nordpol Titans,
Aufnahme von Voyager 1
am 12.11.1980 aus 435000 km Höhe
Die Titanatmosphäre rotiert schneller als der Titankörper,
ein Phänomen, das Superrotation genannt
wird. Das bedeutet, dass in der Atmosphäre Westwinde herrschen,
und zwar in 50 km Höhe mit einer
Geschwindigkeit von 140–180 km/h (entspricht einer Rotation, die ca.
fünfmal so schnell wie die Rotation
des Titankörpers ist). Die Sonde Huygens maß in ca. 120
km Höhe sogar eine Windgeschwindigkeit
von ungefähr 430 km/h. Die Superrotation ist vermutlich auch die
Ursache für charakteristische
Formen bestimmter Oberflächenmerkmale: viele helle Flecke in einem
bestimmten Gebiet
haben scharfe West-, aber verwischte Ostränder, außerdem
besitzen einige dieser
Flecke Stromlinienform (siehe Abbildung).

Eine wichtige Frage ist, warum Titan der
einzige Mond im Sonnensystem mit einer
dichten Atmosphäre ist. Die anderen wegen ihres Sonnenabstandes
und ihrer
Größe noch in Frage kommenden Monde sind die Galileischen
Jupitermonde
Io, Europa, Ganymed und Kallisto sowie der Neptunmond Triton. Die
Jupitermonde sind vermutlich noch zu nah an der Sonne, obwohl sie
fünfmal so weit von ihr entfernt sind wie die Erde: ihre Anziehungs-
kräfte dürften nicht ausreichen, –140 °C kalte atmosphärische
Gase
dauerhaft zu halten. Triton hingegen ist so weit von der Sonne
entfernt, dass seine Oberfläche eine Temperatur von –235 °C
hat, bei der die allermeisten Stoffe bereits gefroren sind.
Höchstwahrscheinlich gibt es auf Titan
eine Art Wasserkreislauf wie auf der Erde, mit
Wolken, Regen, Flüssen und Seen, nur nicht aus Wasser, sondern
aus Methan und
Ethan. Methanwolken in etwa 20 km Höhe und flüssiges oder
gefrorenes Methan auf
der Oberfläche sind bereits sicher, zuletzt wurde sogar ein (flüssiger)
See entdeckt und
darin flüssiges Ethan nachgewiesen. Im Vergleich zur Erde ist
Titan
jedoch klein, rotiert
sehr langsam, wird nur schwach von der Sonne beschienen und hat eine
sehr dichte
und dicke Atmosphäre. Vermutlich laufen daher viele Prozesse nicht
wie bei uns ab,
beispielsweise dürfte es ein von Hoch- und Tiefdruckgebieten bestimmtes,
wechselhaftes Wetter wie in Mitteleuropa auf Titan
nicht geben.
Auch Wirbelstürme werden nicht erwartet.
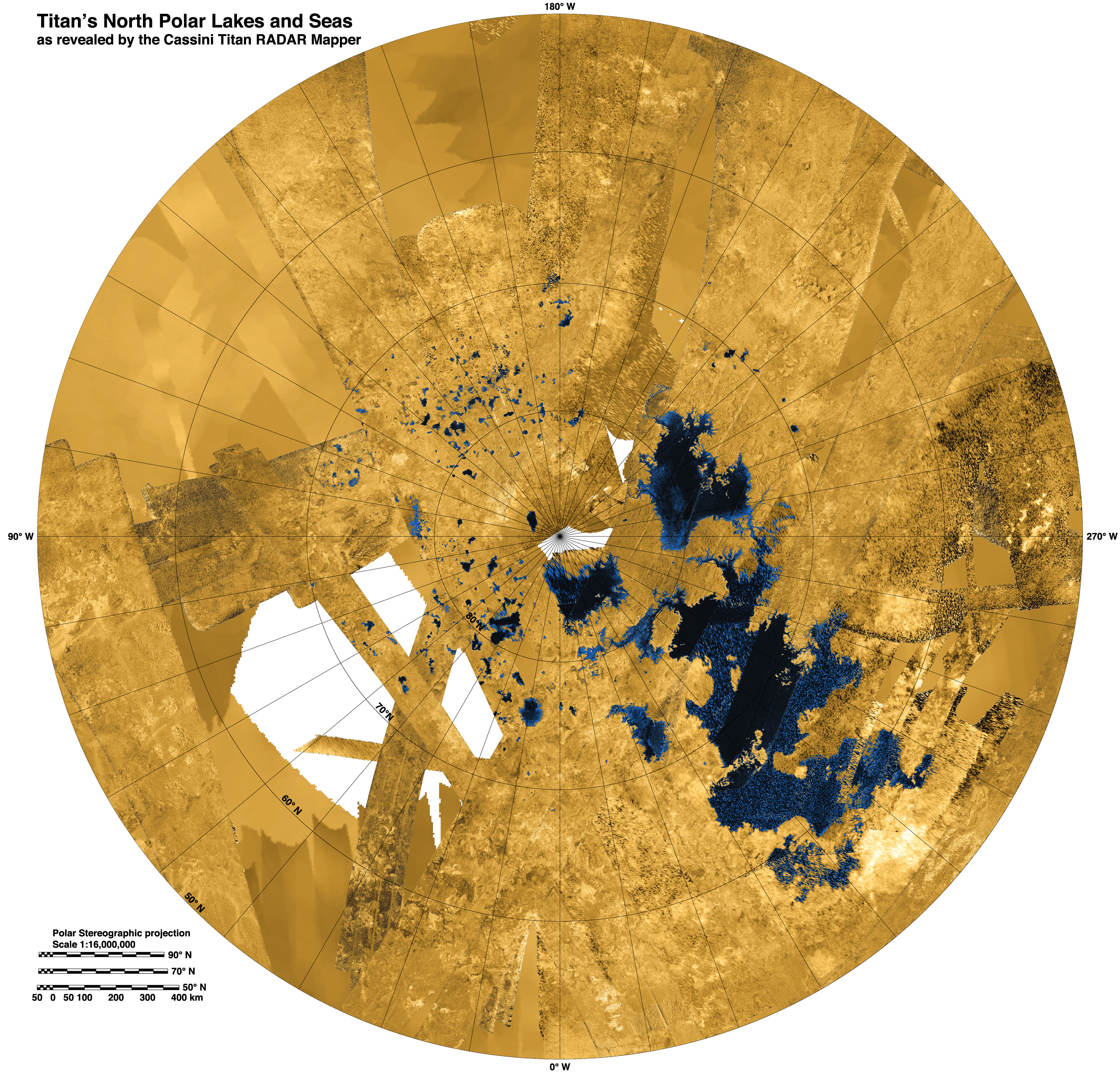
Nordpolar-Seen und -Meere auf Titan. Mosaik aus
Falschfarbenaufnahmen von der Raumsonde Cassini.
Flüssiger Kohlenwasserstoff (blau) und trockenes
Land (braun).
Außerdem deutet die verblüffende Entdeckung von Argon 40
in der Atmosphäre darauf hin,
dass es auf Titan zu Vulkanausbrüchen
gekommen ist, bei denen allerdings im Gegensatz zu
denen auf der Erde nicht Lava, sondern Eis und Ammoniak ausgestoßen
wurden.
Die Verhältnisse auf Titan ähneln
denen auf der Erde vor rund 3,8 Milliarden Jahren,
als sich in der reduzierenden (sauerstofflosen) Uratmosphäre und
Ursuppe die ersten
Lebensbausteine, die Aminosäuren, bildeten. Allerdings sind die
Temperaturen auf
Titan um rund 300 Grad niedriger als weiland
auf der Erde. Die Bildung von Leben
auf dem Saturnmond ist gewissermaßen eingefroren, noch bevor
sie richtig begann.

Titan ist wohl eine seltsame Welt: Die
Felsen bestehen nicht aus Silikatgestein, sondern aus Eis, das wegen der
herrschenden Temperaturen um –180 °C hart wie Stein ist; die Seen
und der Regen (wenn denn vorhanden)
nicht aus Wasser, sondern aus Methan oder Ethan. Die Regentropfen,
die aus Wolken aus Methan oder
Ethan fallen, könnten riesig sein, mit Durchmessern bis zu einem
Zentimeter. Da die Schwerkraft nur ein
Siebentel der Schwerkraft auf der Erde beträgt, fallen sie eher
langsam nach unten: sie brauchen etwa
eine Stunde für den Weg von den Wolken bis zum Boden. Doch in
den meisten Fällen erreichen sie den
Boden gar nicht, sondern verdunsten schon vorher. Wenn aber der Regen
doch einmal die Oberfläche
erreicht, dann bilden sich wohl Flüsse aus Methan oder Ethan,
die sich sintflutartig durch die ansonsten
trockenen Flussbetten ergießen und Seen aus Ethan und darin gelöstem
Methan bilden.
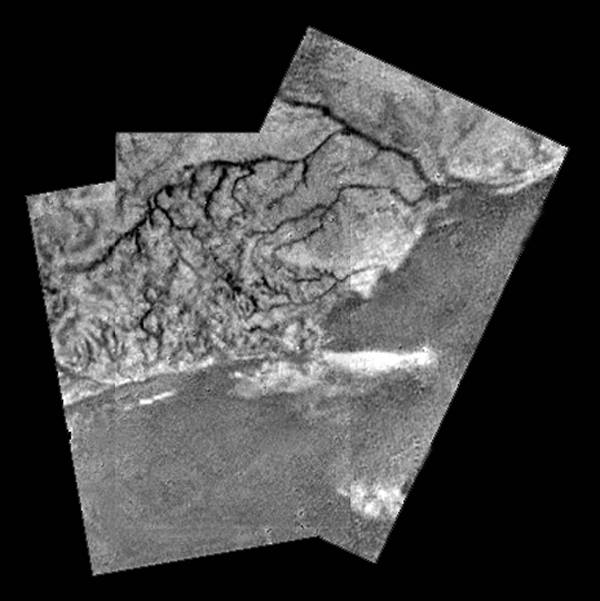
Gebiet mit Flussbetten und Bergrücken,
Mosaik aus Aufnahmen von Huygens am 14.01.2005
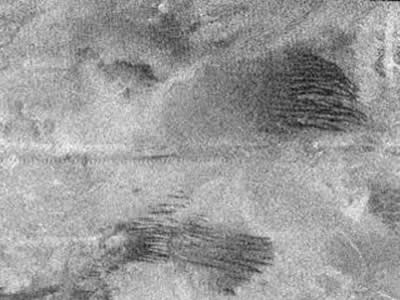
Dunkle, annähernd parallele Linien. Xanadu
Regio.
Das Befahren solcher Flüsse und Seen wäre auch für zukünftige
Astronauten eine
ungewöhnliche Erfahrung: Während auf der Erde in Motorbooten
der Treibstoff
(Benzin) mitgeführt und der Oxidator (Sauerstoff) aus der Umgebungsluft
ent-
nommen wird, könnte auf Titan der
Treibstoff (Ethan und Methan) direkt
aus dem befahrenen "Gewässer" geschöpft werden, während
der Oxidator
(Sauerstoff) durch Bergbau- und Elektrolysemethoden aus dem Ober-
flächeneis gewonnen und in Gasflaschen mitgeführt werden
müsste.
Titans große Bahnhalbachse beträgt
1221870 km (entsprechend ca. 20
Saturnradien), seine Umlaufzeit mithin 15,95 Tage.
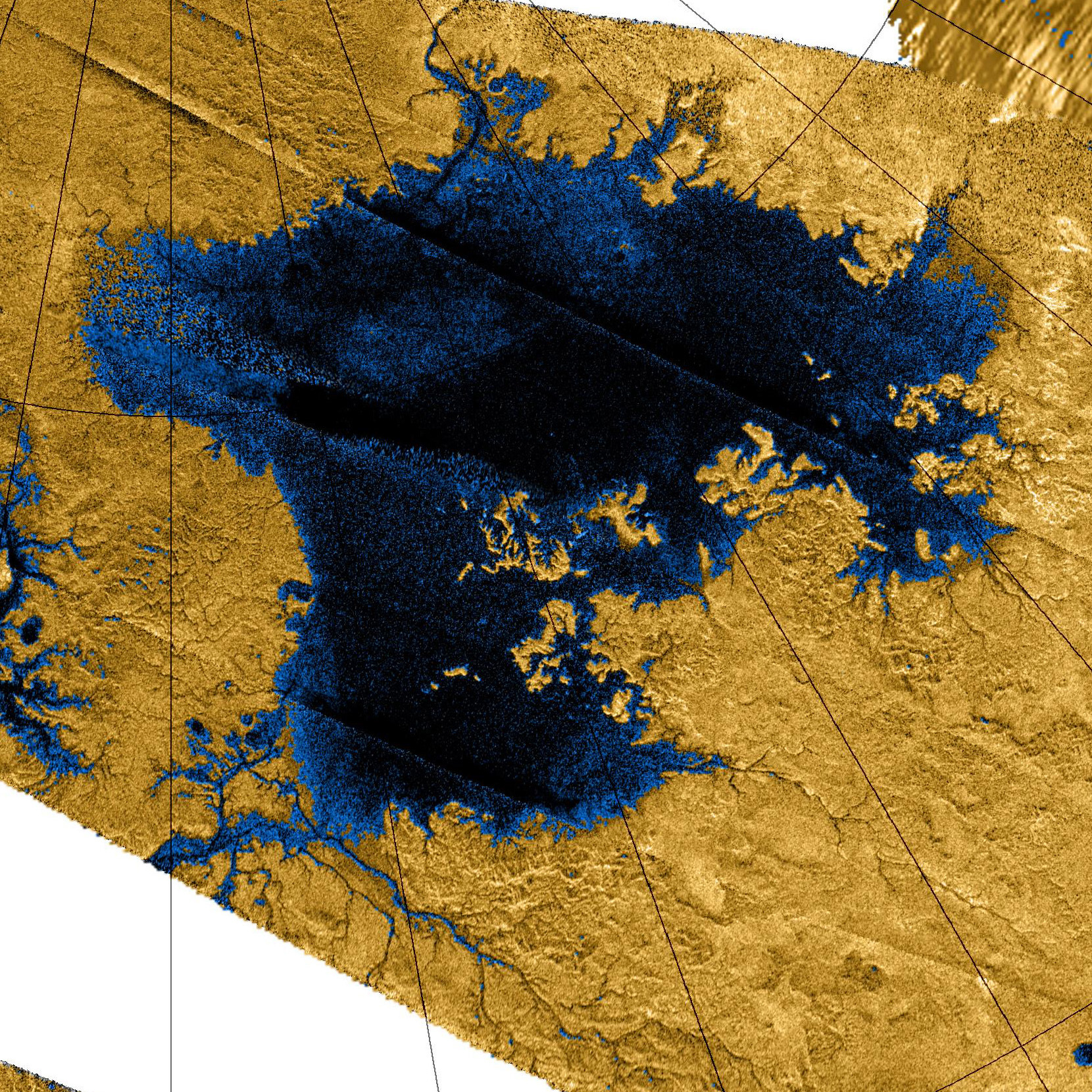
Methan-Meer Ligeia Mare.
Aufnahme von der Raumsonde Cassini.
Eine Laborrekonstruktion verschiedener Geräusche während des
Abstiegs
der Sonde Huygens durch Titans Atmosphäre
gibt es hier.
TITAN in Kürze
